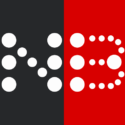Afroamerikanische Kinder haben einer US-Studie zufolge ein dreieinhalb Mal höheres Risiko als ihre weißen Altersgenossen, nach einer Operation zu sterben. Für ihre am Montag veröffentlichte Studie werteten die Forscher der Kinderklinik Nationwide Children’s Hospital in Ohio die Daten von zehntausenden Kindern aus, die zum Zeitpunkt der Operation relativ gesund waren sowie keine chronischen Krankheiten oder andere Begleiterkrankungen hatten, sogenannte Komorbiditäten, wie sie laut Statistik bei Schwarzen in den USA häufiger auftreten als bei Weißen.
Laut den entsprechenden Daten von 172.549 Kindern, die in den Jahren von 2012 bis 2017 in 186 Krankenhäusern operiert wurden, starben nur wenige innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff: Bei den kleinen weißen Patienten starben insgesamt 23 oder 0,02 Prozent, bei den schwarzen waren es 13 – oder 0,07 Prozent und damit dreieinhalb Mal mehr entsprechend des Patientenanteils.
Von ihnen litten zudem 16,9 Prozent an postoperativen Komplikationen oder mussten nach dem Eingriff nochmals operiert werden. Bei den weißen Kindern waren es 13,8 Prozent.
Für diese Unterschiede listen die Autoren eine ganze Reihe möglicher medizinischer, sozialer und wirtschaftlicher Ursachen auf, da die sozio-ökonomische Situation vieler US-Bürger nach wie vor stark von ihrer Hautfarbe abhängt: Unter anderem verweisen sie auf frühere Studien, wonach Afroamerikaner häufiger postoperative Komplikationen entwickeln, auf mögliche Kommunikationsprobleme zwischen Arzt und Patient, bewusste oder unbewusste Voreingenommenheit der Ärzte, Armut oder einen eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsvorsorge.
Afroamerikanischen Kindern stehen für Operationen zudem oftmals nur die weniger qualifizierten Krankenhäuser in ihrer Nachbarschaft zur Verfügung. Möglicherweise sind Ärzte auch weniger bereit, Klagen ihrer afroamerikanischen Patienten über Schmerzen und gesundheitliche Probleme ernst zu nehmen, wie bereits andere Studien zeigten.
Die Forscher weisen in ihrer in der Zeitschrift „Pediatrics“ veröffentlichten Studie lediglich darauf hin, dass das Phänomen mehrere Ursachen habe, ohne aber einen direkten Zusammenhang herzustellen. Nach ihren Worten könnte ihre Analyse jedoch künftigen Studien helfen, die „Mechanismen“ besser herauszuarbeiten, die zu den unterschiedlichen post-operativen Ergebnissen führen. Zudem könne sie das Bewusstsein der Ärzte für diese Unterschiede stärken.