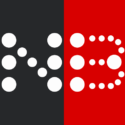Oscar hat es geschafft. Monatelang war der 12-Jährige aus Guatemala unterwegs. Jetzt ist er in den Vereinigten Staaten angekommen – allein. Verängstigt und hungrig steigt er aus dem Schlauchboot, in dem ihn Schlepper über den Grenzfluss Rio Grande nach Texas brachten. „Ich bin gekommen, weil wir nichts mehr zu essen hatten“, erzählt der schmächtige Junge mit den großen braunen Augen, während die Nacht über dem Tal hereinbricht.
Seine Mutter, mit der er allein lebte, habe ihre Arbeit als Putzfrau wegen der Pandemie verloren, sagt Oscar. Beim Abschied habe sie ihm gesagt: „Weine nicht.“ „Aber ich habe geweint“, sagt er und dann schießen ihm wieder die Tränen in die Augen. Oscar hofft, dass er bald zu seinem Onkel kann, der seit 15 Jahren in den USA lebt und in Los Angeles Arbeit als Maler hat.
Zehntausende Migranten kamen in den vergangenen Wochen über die mexikanische Grenze in die USA, die Anlagen der Grenzpolizei und die Haftanstalten sind längst überfüllt. Der Andrang der Flüchtlinge hat sich in den zwei Monaten seit seinem Amtsantritt zu einer der größten Herausforderungen für Präsident Joe Biden entwickelt.
Der schrecklichste Teil der Reise seien die zwölf Stunden in einem mit Menschen vollgestopften Anhänger gewesen, sagt Oscar. „Es war heiß und alle fielen in Ohnmacht“, sagt er. Auch Oscar selbst.
Aber es gibt auch schöne Erinnerungen an die Flucht. Wie die an den Freund, den er unterwegs kennenlernte und später wieder aus den Augen verlor. „Er sagte mir, ich solle nicht aufgeben, wir müssten es schaffen, mit Gottes Gnade“, erinnert sich Oscar. „Und er sagte mir, dass ich dort ein besseres Leben haben werde.“ Eines Tages will Oscar in den USA studieren – und seine Mutter nachholen.
Zusammen mit Oscar überquerten am Samstagabend mehr als 70 Migranten die Grenze. Die meisten stammen aus Guatemala und Honduras, zwei aus Rumänien. Über 20 waren unbegleitete Jugendliche und Kinder, manche erst sieben Jahre alt.
Vom Flussufer führt ein sandiger Weg durch Dornengestrüpp zu den wartenden Grenzpolizisten. Überall liegen die bunten Plastikarmbänder, die die Schlepper den Flüchtlingen anlegen, um sie zu identifizieren. Dazwischen einzelne Schuhe, eine Babyrassel, honduranisches Geld.
Die Polizei nimmt die Neuankömmlinge in Gewahrsam. Manche Familien werden bis zur Anhörung wegen ihrer Asylanträge freigelassen, andere abgeschoben, genauso wie alle allein reisenden Erwachsenen. Minderjährige versuchen die Behörden zu ihren Angehörigen zu bringen.
Bidens Vorgänger Donald Trump wollte die 3200 Kilometer lange Grenze zu Mexiko völlig abriegeln. Biden hat diese Politik der Abschottung kritisiert und fährt einen neuen Kurs in der Einwanderungspolitik. Doch auch er will die Grenze nicht öffnen. Aber der Umgang mit den Migranten hat sich mit dem Machtwechsel in Washington verändert.
„Wir werden keine Kinder unter 18 Jahren auf diese gefährliche Reise zurückschicken“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, bei „Fox News Sunday“. „Das bedeutet nicht, dass sie in den Vereinigten Staaten bleiben dürfen. Wir wollen sie menschlich behandeln und sicherstellen, dass sie an einem sicheren Ort sind, während ihre Fälle entschieden werden.“
Im Februar überquerten fast 100.000 Migranten illegal die Grenze, unter ihnen mehr als 9400 Minderjährige. Nachdem ihre Zahl zu Beginn der Pandemie zurückgegangen waren, steigt sie jetzt wieder.
Unmittelbar nach ihrer Ankunft befragt, nannten die Migranten Armut, Gewalt und Arbeitslosigkeit als Gründe für ihre Flucht. Die Pandemie und die jüngsten Wirbelstürme in Mittelamerika haben die Situation für viele verschlimmert.
Viele Kinder und Jugendliche träumen davon, nach Jahren der Trennung wieder mit ihren Eltern vereint zu sein. Die Mutter des 17 Jahre alten Diego aus Guatemala ging in die USA, als er gerade einen Monat alt war. Sobald er US-Boden betreten hat, leiht er sich ein Handy und ruft sie an. „Sie fing an zu weinen und ich auch“, sagt er. „Ich fühle eine große Leere in meinem Herzen und die möchte ich wieder mit ihrer Liebe füllen.“