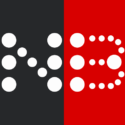George Floyds qualvoller Tod erschütterte vor einem Jahr die USA und sorgte weltweit für Schlagzeilen. Am 25. Mai 2020 wurde der Afroamerikaner in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet, der ihm neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken drückte. Es folgten nicht nur landesweite Proteste gegen Polizeigewalt gegen Schwarze, sondern auch eine intensive Debatte über Rassismus in den USA. Viele hofften auf einen tiefgreifenden Wandel. Doch ein Jahr nach Floyds Tod ist unklar, wieviel sich tatsächlich bewegt hat.
Da sind unter anderem immer neue tödliche Polizeieinsätze. Ende März erschoss ein weißer Polizist in Chicago den erst 13-jährigen Latino-Jungen Adam Toledo bei einer Verfolgungsjagd. Mitte April töte nahe Minneapolis eine Polizistin den 20-jährigen Schwarzen Daunte Wright, als sie offenbar versehentlich anstelle ihrer Elektroschockpistole ihre Schusswaffe abfeuerte.
Zehn Tage später starb in einer Kleinstadt im Bundesstaat North Carolina der Afroamerikaner Andrew Brown Jr. im Kugelhagel der Polizei, als er sich mit seinem Auto seiner Festnahme entziehen wollte.
„Ich dachte wirklich, dass der Tod meines Bruders der letzte Fall von Polizei-Brutalität sein würde“, sagte George Floyds Schwester Bridgett kürzlich. „Aber wie wir alle sehen können, geht es weiter. Immer weiter.“
In zahlreichen Bundesstaaten wurden zwar nach Floyds auf einem schockierenden Handyvideo festgehaltenen Tod die Regeln für Polizisten verschärft; doch nach wie vor haben Sicherheitskräfte bei Fehlverhalten wenig zu befürchten. Ein nach Floyd benanntes umfassendes Polizei-Reformgesetz hat zwar das US-Repräsentantenhaus passiert, steckt aber im Senat fest.
Und angesichts steigender Mordraten in vielen Städten – unter anderem eine Folge der durch die Corona-Pandemie verursachten Wirtschaftskrise – gibt es Gegenwind gegen Bemühungen, der Polizei Finanzmittel zu entziehen und das Geld etwa in Sozialarbeit zu stecken.
Dass Floyds Tod nicht ungesühnt bleibt, das steht fest: Eine Geschworenen-Jury sprach den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin vor einem Monat in allen Anklagepunkten schuldig, darunter im Hauptanklagepunkt Mord zweiten Grades. Das Strafmaß soll am 25. Juni verkündet werden, Chauvin steht eine lange Gefängnisstrafe bevor.
Präsident Joe Biden sagte im April, der Schuldspruch gegen den Ex-Polizisten könne „ein riesiger Schritt beim Marsch hin zu Gerechtigkeit werden.“ Ausreichend sei er aber bei weitem nicht: „Wir müssen systemischen Rassismus und die Ungleichbehandlung von Minderheiten bei Polizei und Justiz anerkennen und ihnen entschieden entgegentreten.“
Doch weitreichende Reformen sind angesichts der Polarisierung in den USA und den erbitterten Grabenkämpfen zwischen Bidens Demokraten und den konservativen Republikanern nur schwer vorstellbar. Das zeigt schon der Streit um das von vielen Republikanern abgelehnte Polizei-Reformgesetz.
Auch durch die Bevölkerung geht ein Riss. Hatte es nach Floyds Tod eine Welle der Unterstützung für die Bewegung Black Lives Matter – das Leben von Schwarzen zählt – gegeben, brach der Zuspruch schnell wieder ein.
Die Politologen Jennifer Chudy und Hakeem Jefferson hoben jüngst in der „New York Times“ hervor, bei Weißen insgesamt und insbesondere bei Anhängern der Republikaner gebe es inzwischen sogar weniger Unterstützung für Black Lives Matter als vor Floyds Tod. Grund sei die „Politisierung des Themas durch die Eliten“: Die Republikaner – allen voran der damalige Präsident Donald Trump – hätten schnell den Fokus weg von der Tötung Floyds auf Ausschreitungen am Rande der Anti-Rassismus-Proteste gelegt.
„Es war ein schmerzhaftes Jahr“, sagte Floyds Schwester Bridgett am Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung für ihren Bruder. „Es war für mich und meine Familie sehr frustrierend.“
Doch der Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt geht weiter. Dazu gehört auch Symbolpolitik: Am Dienstag, dem ersten Jahrestag von Floyds Tod, wird Präsident Biden die Angehörigen des Afroamerikaners im Weißen Haus empfangen.