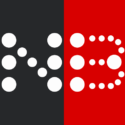Das Eingeständnis von Schmerz, von Enttäuschung und Autoritätsverlust zählt nicht unbedingt zum Standard-Repertoire von Politiker-Reden. In ihrer letzten Ansprache als CDU-Chefin vor einem Parteitag machte Annegret Kramp-Karrenbauer keinen Hehl daraus: Ihr Abgang als Chefin, die Umstände ihres Scheiterns, haben weh getan. Nur zwei Jahre konnte sie sich an der Spitze der Partei halten. Am Samstag wird ihr Nachfolger gewählt.
„Euren Erwartungen und meinen eigenen Ansprüchen nicht immer gerecht geworden zu sein, das schmerzt auch heute noch“, sagte die Saarländerin am Freitag in ihrer Online-Rede auf dem digitalen Bundesparteitag. „Ich weiß, dass viele von euch, die mich gewählt haben, sich mehr von mir erhofft haben und über Fehler enttäuscht waren.“
Dabei hatte sie es so weit gebracht: Der nächste Karriereschritt, die Kanzlerschaft, war nur noch eine Frage der Zeit – so schien es jedenfalls, als Kramp-Karrenbauer vor 25 Monaten zur Chefin der Bundes-CDU gewählt wurde.
Die Frau aus dem Saarland verkörperte einen Typus Politikerin, der ideal in die Zeit zu passen schien. Gänzlich uneitel trat sie auf, unaufgeregt, bodenständig: Eine Frau, die ihren Machtinstinkt hinter einem Image von Fleiß und Bescheidenheit zu verbergen wusste. Wie geschaffen schien sie für die Nachfolge von Angela Merkel.
Es kam dann alles anders. Kramp-Karrenbauer erklärte im Februar vergangenen Jahres ihren Rücktritt wegen des Streits um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit Stimmen der CDU und der AfD. Der thüringische Landesverband hatte sich gegen Vorgaben der Bundes-CDU gestellt.
Die CDU habe sich damals in einer „existenziell schwierigen Situation“ befunden, sagte Kramp-Karrenbauer nun vor den CDU-Delegierten. „Es ging dabei nicht nur um eine regionale Frage, es ging um die Seele unserer Partei.“ Sie habe damals gespürt, „dass ich als Parteivorsitzende nicht mehr genügend Autorität und Unterstützung hatte, um unsere Partei unbeschadet durch diese schwierige Phase zu bringen“.
Harsche Kritik hatte Kramp-Karrenbauer in ihrer Amtszeit einstecken müssen. Viele in der CDU sehnten sich nach der langen Ära Merkel und den Kompromissen in der großen Koalition nach einer klareren konservativen Positionierung. Doch Kramp-Karrenbauer konnte sich neben der übermächtigen Kanzlerin nicht als eigenständige politische Impulsgeberin etablieren.
Ihre politischen Erfahrungen hatte Kramp-Karrenbauer im beschaulichen Saarland gesammelt – als volksnahe Vertreterin einer Kleine-Leute-CDU mit tiefer Verwurzelung in der katholischen Soziallehre. Der Wechsel auf die Berliner Bühne war hart. Sie musste lernen: Wer Kanzlerin werden will, kann nicht mit Nachsicht rechnen.
Vor einem Jahr, bei der Ankündigung ihres Rückzugs, schmiss Kramp-Karrenbauer nicht einfach hin. Die getreue Parteisoldatin blieb, um den Übergang zu organisieren. Dass die Übergangsphase letztlich fast ein Jahr dauerte, ist dem Coronavirus und der zweimaligen Verschiebung des Parteitags geschuldet.
Einige Akzente konnte die Bundesverteidigungsministerin in dieser Zeit noch setzen: Sie brachte in den Spitzengremien gegen Widerstand einen Beschluss zur Frauenquote durch. Sie hielt die CDU auf einem Kurs der Mitte. Und sie trug dazu bei, das Verhältnis zur Schwesterpartei CSU zu reparieren.
Somit konnte Kramp-Karrenbauer in ihrer Abschiedsrede auch auf positive Aspekte ihrer Bilanz verweisen. „Die CDU ist bereit für das Wahljahr 2021“, resümierte sie. „Die CDU ist organisatorisch und programmatisch weitergekommen.“