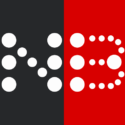Zehn Jahre nach dem Reaktorunglück im japanischen Fukushima sieht das Bundesamt für Strahlenschutz die Katastrophe als wichtige Wegmarke auch für Deutschland. Diese habe gezeigt, „dass Kernkraft selbst für hochentwickelte Industriegesellschaften ein besonders hohes Risiko darstellt“, erklärte BfS-Präsidentin Inge Paulini am Dienstag. Auch hierzulande seien danach Notfallpläne neu aufgestellt worden.
Durch das Reaktorunglück vom 11. März 2011, das durch ein Erdbeben mit nachfolgendem Tsunami ausgelöst worden war, gelangten damals große Mengen radioaktiver Stoffe in die Umwelt. Rund 300 Quadratkilometer in der Region Fukushima sind weiterhin Sperrgebiet und dürfen nur eingeschränkt betreten werden.
Auch wenn außerhalb der Sperrzone die Strahlenbelastung inzwischen wieder weitgehend auf Normalniveau abgesunken sei, sind die Folgen für die Region laut BfS nach wie vor beträchtlich, Gesundheitsauswirkungen seien noch nicht endgültig abzusehen.
In Deutschland war die Katastrophe Anlass zur Stilllegung der sieben ältesten damals noch in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke gewesen. Nachdem die regierende schwarz-gelbe Koalition zunächst Akw-Laufzeiten verlängert hatte, wurde nach Fukushima auch der Atomausstieg insgesamt wieder beschleunigt und neu festgeschrieben. Von den sechs derzeit noch verbliebenen deutschen Atomkraftwerken sollen nun drei in diesem Jahr und die letzten drei im kommenden Jahr vom Netz gehen.
Zudem wurde auch hierzulande die Katastrophenvorsorge nach dem Unglück in Japan ausgebaut. Der Notfallschutz für Unfälle oder Ereignisse mit Freisetzungen von radioaktiven Stoffen sei grundlegend überarbeitet worden. So habe das BfS veranlasst, dass die Gebiete um die Kernkraftwerke, in denen Schutzmaßnahmen konkret vorgeplant waren, ausgeweitet wurden, um die Bevölkerung besser zu schützen, erklärte Paulini. Auch die Verteilung von Jodtabletten als Vorsorgemaßnahme sei neu geregelt worden.