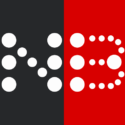69 Tage saßen die 33 Bergleute in 600 Metern Tiefe fest. Die ganze Welt nahm Anteil an dem Grubenunglück in der chilenischen Atacama-Wüste und der spektakulären Rettung nach über zwei Monaten. Die Kumpel wurden zum Symbol der Hoffnung und der Solidarität. Zehn Jahre später herrschen Verbitterung und Neid unter den Überlebenden.
Die Bergarbeiter hatten gerade zu Mittag gegessen, als am 5. August 2010 ein Erdrutsch die Männer im Alter von damals 19 bis 63 Jahren in ihrem Schacht einsperrte. Es dauerte 17 Tage, bis ein erstes Lebenszeichen aus der jahrhundertealten Kupfermine nach außen drang und weitere 52, bis sie in einer spektakulären Aktion durch einen engen Tunnel gerettet wurden.
Die Kumpel wurden als Helden gefeiert, die Hunger und Hoffnungslosigkeit gemeinsam gemeistert hatten. Sie wurden beschenkt, reisten um die Welt und trafen Hollywoodstars. Ihre Geschichte wurde mit Antonio Banderas in der Hauptrolle verfilmt.
Aber das Glück nach dem Unglück war von kurzer Dauer. „Ich habe Albträume und kann schlecht schlafen“, sagt José Ojeda. Er hatte damals den durch eine Sonde übermittelten Zettel mit der kurzen Botschaft „Uns geht es gut“ geschrieben, durch den die Welt erfuhr, dass alle Bergleute das Unglück überlebt haben.
Heute leidet der 57-Jährige an Diabetes und läuft auf Krücken. Mit Frau und Tochter lebt er in der Regionalhauptstadt Copiapó, die 320 Dollar (272 Euro) staatlicher Rente reichen nicht für seine Medikamente. „Die Leute dachten, wir bekämen einen Haufen Geld. Aber das stimmt nicht“, sagt Ojeda.
Nach acht Jahren Rechtsstreit wurde der Staat dazu verurteilt, jedem der Bergarbeiter 110.000 Dollar Entschädigung zu zahlen; der Minenbetreiber wurde von der Verantwortung frei gesprochen. Die Regierung focht die Entscheidung an, ein endgültiges Urteil steht noch aus.
Jimmy Sánchez war der Jüngste der Verschütteten. „Es ist, als ob es gestern passiert wäre. Ich denke, ich werde das nie vergessen können“, sagt Sánchez, der ebenfalls in Copiapó lebt. Nie mehr seit dem Unglück hat er seinen Arbeitshelm getragen, einen neuen Job zu finden ist schwer. „Sobald sie herausfinden, wer ich bin, bleiben die Türen für mich zu“, sagt er.
Aus psychologischen Gründen ließ das Bergbauunternehmen Sánchez nicht mehr zurück in den Schacht. Mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt er von der staatlichen Rente – in einem Haus mit 20 weiteren Menschen. Sein großer Traum, ein eigenes Haus, konnte er sich nie erfüllen.
Omar Reygadas war einer der erfahrensten Bergarbeiter. Nach dem Unglück wurde er Chauffeur; die Corona-Pandemie machte den 67 Jahre alten Witwer arbeitslos. „Alles, was wir in der Mine und danach durchgemacht haben, ist für uns noch lebendig“, sagt er.
Die 33 Kumpel kannten sich kaum, als sie plötzlich auf Gedeih und Verderb einander ausgeliefert waren. Trotzdem organisierten sie sich rasch in der Dunkelheit und der feuchten Hitze ihres Verlieses. Für jeden gab es alle 48 Stunden zwei Teelöffel Thunfisch und ein halbes Glas Milch. Die Männer waren so diszipliniert, dass sie bei ihrer Rettung noch zwei Dosen Thunfisch übrig hatten.
„Was uns mit am meisten geholfen hat, war unser Humor. Selbst in den schlimmsten Momenten haben wir gelacht“, erinnert sich Mario Sepúlveda, der unter Tage als Unterhalter der Gruppe galt. „Wir haben gesungen, vor uns hingeträumt, Entscheidungen demokratisch getroffen und niemanden fallen lassen“.
Doch mit der Verbundenheit war es schnell vorbei. Zum zehnten Jahrestag werden sich die Schicksalsgenossen nicht wiedersehen. „Nachdem wir draußen waren, kämpfte jeder nur noch für sich allein“, sagt Sepúlveda. Sánchez macht den Streit ums Geld für die Film- und Buchrechte und die Anwälte dafür verantwortlich. „Sie spalteten uns“, sagt er.
Manche Kumpel stehen immer noch im Rampenlicht. Der 49-jährige Sepúlveda tritt als Motivationstrainer auf und gewann bei einer Reality-Survival-Show 150.000 Dollar. Auch Neid auf derartige Erfolge entzweit die Bergarbeiter. „Manche denken nur noch ans Geld und vergessen alles, was wir zusammen durchgestanden hatten“, sagt Sánchez.
Die Männer sind immer noch wütend, dass der Staat sie nicht besser entschädigt. Und auch die psychologische Unterstützung endete nach einem Jahr. Sepúlveda würde dennoch alles dafür geben, wieder unter Tage arbeiten zu dürfen. „Ich will wieder zurück und meine Erfahrung weitergeben“, sagt er. „Ich liebe die Arbeit in der Mine“.