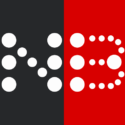In Deutschland können einem Zeitungsbericht zufolge künftig digitale Apps auf Rezept verschrieben werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlicht am Dienstag erstmals eine Liste mit verschreibungsfähigen digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGa), wie die „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“ (Montagsausgabe) berichteten. Auf dieser ersten DiGa-Liste stehen demnach zunächst zwei Apps. Sie werde fortlaufend ergänzt.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte den Stuttgarter Blättern, das DiGa-Verzeichnis sei „eine Weltneuheit“. „Deutschland ist das erste Land, in dem es Apps auf Rezept gibt.“ Das Bundesgesundheitsministerium wollte dem Bericht zufolge zunächst nicht mitteilen, um welche beiden Apps es sich handelt.
Das Bundesinstitut geht davon aus, „dass kurzfristig weitere Anwendungen in die Prüfung und ins DiGA-Verzeichnis kommen werden“, wie ein Sprecher den beiden Zeitungen sagte. Derzeit befänden sich neben den beiden Apps, die als erste ins DiGA-Verzeichnis kommen, 25 weitere im Prüfverfahren. Für rund 75 Anwendungen führte das Innovationsbüro des BfArM demnach bereits Beratungsgespräche mit den Herstellern. Insgesamt gebe es rund 500 Anfragen von Herstellern.
Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sagte allerdings den Stuttgarter Zeitungen, Apps müssten „Mehrwert für den Patienten bringen und verständlich und sicher sein – sowohl bei der Funktionalität als auch beim Datenschutz.“ Der größte Teil der bisherigen Gesundheitsapps „konnte diesen Ansprüchen nicht genügen“, fügte Gassen hinzu.
Aus der Politik gab des laut dem Bericht unterschiedliche Reaktionen. Der CDU-Gesundheitsexperte Michael Hennrich sprach demnach von einem „wichtigen Signal an Entwickler und Start-up-Unternehmen“, zeigte sich aber auch überrascht, dass der Prozess „eine gewisse Zeit in Anspruch genommen hat“.
Kritik übte die Grünen-Gesundheitsexpertin Maria Klein-Schmeink. Eine wirkliche Verbesserung der Versorgung werde „nicht erreicht“, sagte sie den Zeitungen. Es gebe im Bundesinstitut „viel zu wenig Stellen, um den Nutzen und die Einhaltung der geltenden Datenschutzvorgaben gründlich zu prüfen.“