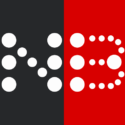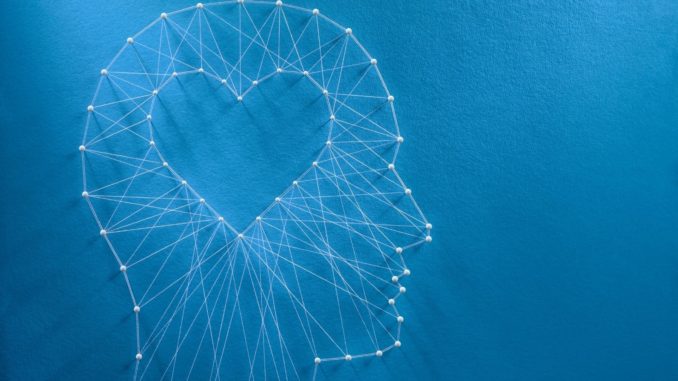
Hab dich nicht so, das wird schon wieder“ – bis heute fallen solche Sätze, wenn es um psychische Erkrankungen geht. In der gesetzlichen Sozialversicherung begann erst Ende der 90er Jahre die Rentenversicherung anzuerkennen, dass die Psyche erwerbsunfähig machen kann. Nach einem in seiner Geschichte vermutlich einmaligen Beschluss des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel, der am Donnerstag verkündet wurde, könnte dem nun auch die gesetzliche Unfallversicherung folgen. (Az: B 2 U 11/20 R)
Der konkrete Fall ließ bei manchem Teilnehmer der BSG-Verhandlung die Frage aufkommen, warum es darüber überhaupt einen Streit geben konnte. Der Kläger war Rettungssanitäter beim Roten Kreuz im Landkreis Esslingen bei Stuttgart. 2016 wurde in einer Klinik eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert, die er als Berufskrankheit anerkannt haben möchte.
Zur Begründung verweist er auf viele belastende Ereignisse. So war er 2009 beim Amoklauf in Winnenden und Wendlingen im Einsatz, bei dem ein 17-jähriger 15 Menschen und zuletzt sich selbst tötete. 2014 war er mit dem Anblick einer Jugendlichen konfrontiert, die sich durch Selbstenthauptung getötet hatte. Am Jahrestag genau ein Jahr später war wieder er im Einsatz, als die beste Freundin des Mädchens auf ähnlich grausame Art Suizid beging.
2016 brach der Rettungssanitäter buchstäblich zusammen und wurde mit der Diagnose PTBS aus einer Klinik der Deutschen Rentenversicherung entlassen. Heute ist er arbeitsunfähig, leicht gereizt, kann sich kaum zwei Stunden konzentrieren. Seine Ehe ging in die Brüche, er lebt sozial zurückgezogen.
Die Unfallversicherung Bund und Bahn meinte jedoch, es gebe keine gesicherten Erkenntnisse, dass die wiederholte Konfrontation mit solchen Ereignissen geeignet sei, eine psychische Störung auszulösen. Auch das Sozialgericht und das Landessozialgericht in Stuttgart folgten dem.
Nur vor dem Hintergrund der gewachsenen Strukturen der gesetzlichen Unfallversicherung lässt sich der Grund dafür verstehen. Neben Arbeitsunfällen kommt diese auch für die Folgen von Berufskrankheiten auf, „die nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind, denen bestimmte Personengruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind“.
Welche Krankheiten das sind, bestimmt weitgehend der beim Bundesarbeitsministerium angesiedelte sogenannten Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten. Dessen Vorschläge werden in der Regel in die Verordnung aufgenommen. Derzeit beschäftigen sich die Sachverständigen unter anderem mit Knieverletzungen bei Profifußballern. Eine psychische Krankheit dagegen schaffte es noch nie in die Verordnung.
Die Berufsgenossenschaften nehmen die Entscheidungen des Sachverständigenbeirats als Leitplanken und schauen ungern darüber hinaus. Dabei müssen sie laut Gesetz Erkrankungen als sogenannte Wie-Berufskrankheit anerkennen, wenn sie zwar nicht in der Verordnung aufgelistet, die Voraussetzungen aber erfüllt sind.
Zudem sind die Berufsgenossenschaften gesetzlich aufgefordert, „durch eigene Forschung oder durch Beteiligung an fremden Forschungsvorhaben“ dazu beizutragen, den möglichen Zusammenhang zwischen Arbeit und Krankheiten aufzuklären. In Kassel sagte die Vertreterin der Unfallversicherung Bund und Bahn, sie wisse nicht, ob dies jemals geschehen sei.
Bei den obersten Sozialrichtern in Kassel löste dies alles „ein gewisses Misstrauen“ aus. Um die Klage nun nicht abweisen zu müssen, griffen sie zu einem Kniff. Sie setzten das Verfahren aus, um selbst ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag zu geben. Der BSG-Unfallsenat hatte einen solchen Beschluss noch niemals zuvor gefasst – und auch das gesamte BSG dem Vernehmen nach jedenfalls in den vergangenen 30 Jahren nicht.
Was nun in Kassel geschieht, könnte „einen gewissen Signalwert“ haben, sagte der Vorsitzende Richter des BSG-Unfallsenats, Wolfgang Spellbrink. Der Kasseler Beschluss könnte so der Anerkennung psychischer Erkrankungen als Berufskrankheiten den Weg bahnen. „Die Rechtsprechung wird die Tätigkeit des Verordnungsgebers kritisch begleiten“, kündigte Spellbrink an.